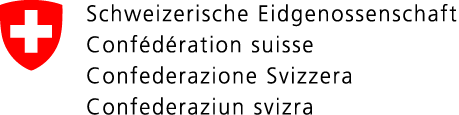Aktion «Kinder der Landstrasse» der Pro Juventute
Der Bundesrat anerkennt Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Jenischen und Sinti und bekräftigt Entschuldigung
An seiner Sitzung vom 19. Februar 2025 hat der Bundesrat ein im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) erstelltes Rechtsgutachten zur Verfolgung der Jenischen und Sinti zur Kenntnis genommen. Er anerkennt, dass die im Rahmen des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» erfolgte Verfolgung der Jenischen und Sinti nach Massgabe des heutigen Völkerrechts als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zu bezeichnen ist. Für das begangene Unrecht bekräftigt der Bundesrat gegenüber den Betroffenen die 2013 ausgesprochene Entschuldigung. Das EDI wird mit ihnen klären, inwiefern über die bereits ergriffenen Massnahmen hinaus noch Bedarf zur Aufarbeitung der Vergangenheit besteht.
Im November 2021 ersuchte die «Union des Associations et des Représentants des Nomades Suisses» (UARNS) den Bund um Anerkennung eines Völkermordes (Genozids) an den Schweizer Jenischen und Sinti in Zusammenhang mit dem «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse». Im Januar 2024 verlangte die Radgenossenschaft der Landstrasse die Anerkennung eines «kulturellen Genozids».
Angesichts der Schwere der Vorwürfe beschloss das EDI, einen unabhängigen Experten beizuziehen. Er beauftragte in Absprache mit den beiden Gesuchstellerinnen im März 2024 Prof. Dr. Oliver Diggelmann (Universität Zürich) mit der Erstellung eines Rechtsgutachtens. Der Auftrag hatte zum Ziel, zu klären, ob die Schweiz eine völkerrechtliche Verantwortung für die Verletzung der Tatbestände «Genozid» oder «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» gegenüber den Jenischen und Sinti trägt.
Das Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass die Kindeswegnahmen, die beabsichtigte Zerstörung von Familienverbänden zur Eliminierung der fahrenden Lebensweise und zur Assimilierung der Jenischen und Sinti nach den heute geltenden völkerrechtlichen Standards als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» im Sinne des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu bezeichnen sind. Der Staat trägt dabei nach heutigem Rechtsverständnis eine Mitverantwortung für die begangenen Taten. Die Verfolgung der Jenischen und Sinti wäre ohne die Mithilfe staatlicher Behörden aller Ebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) nicht möglich gewesen. Es gab insbesondere enge personelle und finanzielle Verflechtungen zwischen dem Bund und der Stiftung «Pro Juventute», die das Programm «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» betrieb.
Der Bundesrat hat ein Schreiben an die Gemeinschaft der Jenischen und Sinti gerichtet, in der er die Entschuldigung des Bundesrates gegenüber den Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen bekräftigt und betont, dass zu diesen Opfern auch die Jenischen und Sinti gehören.
Eine Geschichte geprägt von Verfolgung
Das Verhältnis der offiziellen Schweiz zu den Minderheiten der der Jenischen, Sinti und Roma war bis im 20. Jahrhundert von Ausschluss und Versuchen zur erzwungenen Integration gekennzeichnet.
Die fahrende Lebensweise entsprach nicht der bürgerlichen Norm und galt als unstet und darum verdächtig. Aber auch sesshaft lebende Familien blieben nicht verschont: die Zugehörigkeit zu einer Minderheit alleine reichte oft schon aus, um stigmatisiert und verfolgt zu werden.
Pro Juventute und ihre Aktion «Kinder der Landstrasse»
Mit unvergleichlicher Härte und gezielter Hetze ging die Pro Juventute mit ihrer Aktion «Kinder der Landstrasse» ab 1926 gegen jenische Familien vor, vereinzelt waren auch Sinti betroffen. Die Kinder wurden von Pro Juventute ihren Familien gegen deren Willen entzogen. Sie wurden daraufhin in Heimen oder Anstalten interniert sowie in Fremdfamilien platziert, Kontakte mit der Herkunftsfamilie wurden systematisch unterbunden. Rund 600 Kinder wurden auf diese Weise, oftmals auch mit Hilfe der Behörden, weggenommen und in vielen Fällen dauerhaft von ihrer angestammten jenischen Kultur entfremdet. Am meisten Opfer des Programms der Pro Juventute stammten aus den Kantonen Graubünden, Tessin, St. Gallen und Schwyz.
Eine ähnliche Praxis verfolgten kommunale und kantonale Behörden und teilweise auch Kirchen, vor allem in der Zentral- und Ostschweiz sowie im Kanton Solothurn, so dass die Zahl fremdplatzierter Kinder aus jenischen Familien insgesamt weit höher ist. Schätzungen gehen von bis zu 2’000 Betroffenen aus. Dabei nahmen Organisationen wie das Seraphische Liebeswerk eine Vermittlerrolle zur Platzierung jenischer Kinder in Pflegefamilien, Kinderheimen und Erziehungsanstalten ein. Auch Jugendliche wurden in Arbeitsanstalten und psychiatrische Kliniken eingewiesen und damit von ihren Familien entfremdet und Misshandlungen ausgesetzt. Selbst Zwangssterilisationen wurden ausgeführt.
Erst im Zuge einer breiten öffentlichen Debatte zum Heimwesen und auf Druck der Medien – vorab des «Schweizerischen Beobachters» – wurde das Programm «Kinder der Landstrasse» 1973 eingestellt.
Proteste der Jenischen und Aktenzugang
Die Proteste der Jenischen führten zur Gründung von eigenen Organisationen wie der «Radgenossenschaft der Landstrasse» oder «Naschet-Jenische», die den Betroffenen Zugang zu ihren Akten und damit zu ihren Ursprungsfamilien verschaffen wollten und sich für die historische Aufarbeitung einsetzen.
Ab den 1980er Jahren begann der Bund, sich für die Wiedergutmachung des Unrechts und für die Anerkennung und den Schutz der Minderheiten einzusetzen. Das Wirken der Pro Juventute wurde daraufhin gestützt auf die zugänglich gemachten Akten nach und nach erforscht. Auch die Aufarbeitung der Auswirkungen der bis 1981 praktizierten fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen, deren Opfer häufig auch Jenische, Sinti und Roma waren, wurde an die Hand genommen.
Etappen auf dem Weg der Aufarbeitung
- Bundesrat Alphons Egli entschuldigte sich 1986 im Rahmen der Behandlung der eidgenössischen Stiftungen vor dem Nationalrat für die Beteiligung des Bundes an der Aktion der Pro Juventute.
- 1988 werden im Rahmen der Aufarbeitung der Aktion «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» eine Akten- und eine Fondskommission eingesetzt mit dem Ziel, den Betroffenen die Einsicht in ihre Akten zu ermöglichen. Bis 1992 werden finanzielle Entschädigungen an die Opfer in der Höhe von insgesamt 11 Millionen Franken entrichtet, maximal 20'000 Franken pro Person.
- 1995 gründet der Bund die Stiftung «Zukunft für Schweizer Fahrende». Die Stiftung ermöglicht die Zusammenarbeit unter den Behörden der verschiedenen staatlichen Ebenen und den Organisationen der Jenischen und Sinti. Mit ihrer Arbeit trägt sie zur Verbesserung der Lebensbedingungen der nomadisch lebenden Minderheiten und zur Bewahrung der kulturellen Identität der Jenischen und Sinti bei.
- Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 51 zum Thema Integration und Ausschluss werden von 2003 bis 2009 verschiedene Untersuchungen zur Geschichte der Jenischen, Sinti und Roma veröffentlicht.
- Am 30. September 2016 verabschieden die eidgenössischen Räte das «Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981». Das Gesetz sieht eine finanzielle Entschädigung von 300 Millionen Franken für von Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor, maximal 25'000 Franken pro Person. Akten werden aufbewahrt, Betroffene erhalten Einsicht; der Bundesrat sorgt für eine umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung der Zwangsmassnahmen; die Kantone richten Anlauf- und Beratungsstellen ein. Unter den Betroffenen befinden sich auch zahlreiche Jenische, Sinti und Roma.
- Am 15. September 2016 wendet sich Bundesrat Alain Berset an einer «Feckerchilbi» in Bern an die versammelten Angehörigen der Minderheiten und betont die Wichtigkeit der Eigenbezeichnungen: «Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bund Sie künftig „Jenische" und „Sinti" nennt. Und dass künftig auf den allgemeinen Begriff "Fahrende" verzichtet wird […] mit Sprache schafft man Realität.» Dieser Moment wird von den Jenischen und Sinti als historisch wichtige Anerkennung gefeiert.
- Am 19. Februar 2025 anerkennt der Bundesrat die Verfolgung der Jenischen und Sinti im 20. Jahrhundert als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» und bekräftigt seine Entschuldigung.
Die Aufarbeitung dieses belastenden Kapitels der neueren Geschichte und des Umgangs der Schweiz mit ihren Minderheiten dauert an.